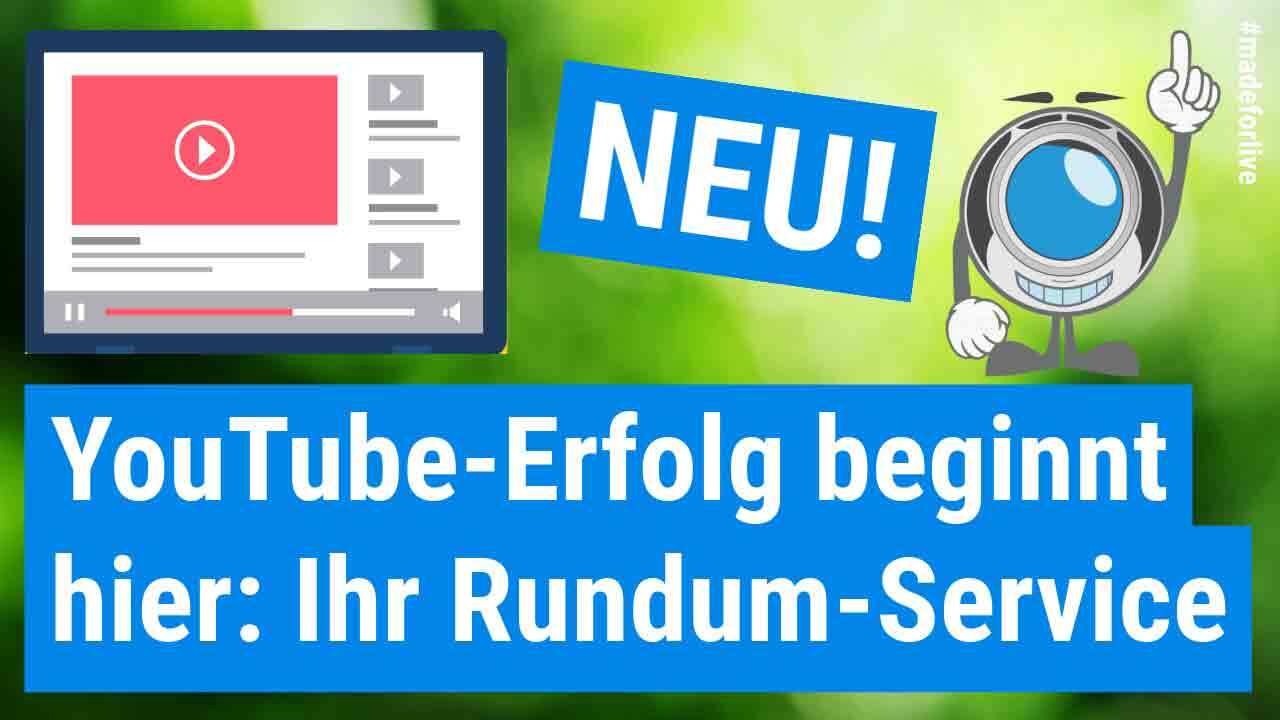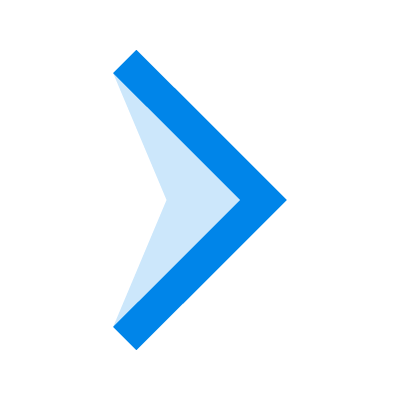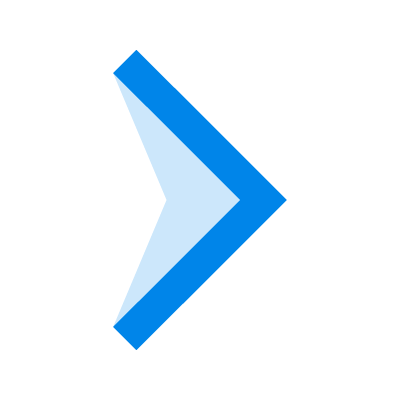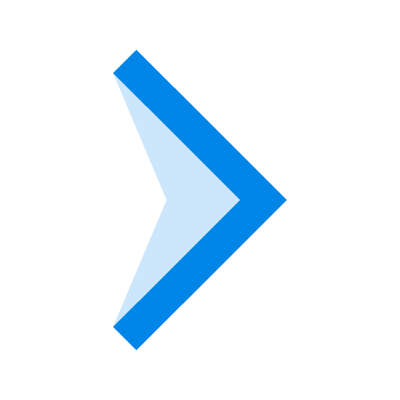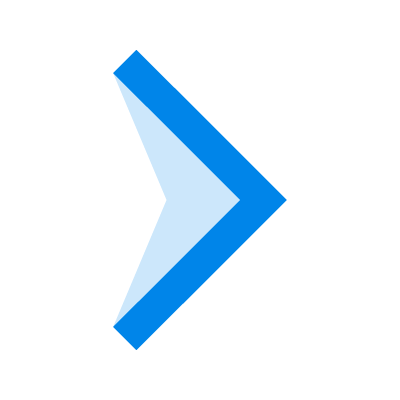DSGVO vs. YouTube: Sichere Livestreams für Kommunen
DSGVO: Warum Kommunen keine YouTube-Livestreams einbetten sollten

YouTube-Livestreams auf kommunalen Webseiten sind beliebt – aber auch riskant.
Was viele Städte und Gemeinden nicht wissen: Schon beim bloßen Einbetten eines Streams werden Daten wie IP-Adressen in die USA übertragen – ein klarer Verstoß gegen die DSGVO.
Dieser Artikel zeigt, warum YouTube problematisch ist, welche Verantwortung Kommunen tragen – und wie es rechtssicher und bürgernah geht.
Warum ist die Einbettung von YouTube-Streams ein Datenschutzproblem?

Sobald ein YouTube-Stream auf einer Webseite eingebunden wird, überträgt der Browser des Besuchers automatisch Daten wie die IP-Adresse und teils auch Cookies an Google. Dabei findet ein sogenannter Drittstaatentransfer in die USA statt. Laut einem Beitrag auf dr-dsgvo.de stellt dies ohne vorherige, informierte und freiwillige Einwilligung der Nutzer einen klaren Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dar. Der "erweiterte Datenschutzmodus" von YouTube ist dabei keine ausreichende Lösung, da er die Datenübertragung nicht vollständig unterbindet.
Der Europäische Gerichtshof hat im sogenannten "Schrems II"-Urteil (2020) das EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt, weil US-Behörden in der Lage sind, auf Daten von EU-Bürgern zuzugreifen, ohne dass diesen wirksame Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Dadurch gelten die USA datenschutzrechtlich nicht als sicheres Drittland (eur-lex.europa.eu). Wer YouTube Livestreams DSGVO-konform einbinden will, steht also vor einem strukturellen Problem.
Politische Entwicklungen in den USA: Ein Risiko für den europäischen Datenschutz?

Die aktuelle politische Entwicklung in den USA verschärft die Situation weiter. Im Januar 2025 berichtete Euronews, dass unter der neuen US-Regierung Maßnahmen zur Einschränkung unabhängiger Datenschutzaufsicht ergriffen wurden. Unter anderem wurde das Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), das eine Kontrollfunktion bei Datenzugriffen amerikanischer Geheimdienste hat, geschwächt. Kritiker warnen, dass der politische Kurs der USA langfristig dazu führen könnte, dass das Land kein verlässlicher Partner mehr für europäische Datenschutzinteressen ist.
Auch The Verge berichtete über zunehmende Bedenken hinsichtlich mangelnder Datenschutzkontrollen bei großen US-Plattformen. Die Federal Trade Commission (FTC) kritisierte, dass Daten über lange Zeit gespeichert und unzureichend geschützt würden.
Öffentliche Stellen in der Pflicht? Datenschutz schafft Vertrauen

Gerade öffentliche Einrichtungen und kommunale Verwaltungen stehen in der Verantwortung, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken – besonders in politisch fragilen Zeiten wie diesen. Sorgsamer Umgang mit personenbezogenen Daten ist dabei ein zentrales Element. Datenschutz ist nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und Transparenz gegenüber der Bevölkerung. Wer ohne ausreichende Hinweise und Einwilligungen Dienste wie YouTube einbindet, gefährdet dieses Vertrauen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) betont in seinen Empfehlungen zur Videoüberwachung durch öffentliche Stellen, dass gerade Behörden eine besondere Verantwortung im Umgang mit personenbezogenen Daten tragen und strenge Anforderungen an Transparenz, Zweckbindung und Verhältnismäßigkeit erfüllen müssen (Einbindung von Videoinhalten).
Selbst wenn eine Kommune transparent auf den Datentransfer hinweist und der Nutzer aktiv zustimmt, bleibt die Einbettung eines YouTube-Livestreams auf einer öffentlichen Webseite problematisch. Öffentliche Stellen haben eine besondere Verantwortung beim Schutz personenbezogener Daten. Den Datenfluss an einen US-Konzern in Kauf zu nehmen – selbst mit Einwilligung – kann das Vertrauen der Bürger:innen untergraben und steht im Widerspruch zum Grundgedanken der DSGVO.
Wer trägt die Verantwortung bei der Einbindung von YouTube-Livestreams?
Viele Kommunen gehen davon aus, dass die datenschutzrechtliche Verantwortung bei YouTube liegt. Tatsächlich ist aber die einbettende Stelle – also die Kommune – selbst Verantwortlicher im Sinne der DSGVO. Gemäß Art. 26 DSGVO kann bei gemeinsam festgelegten Zwecken eine gemeinsame Verantwortlichkeit bestehen, was zusätzliche Dokumentations- und Informationspflichten nach sich zieht. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit YouTube ist nicht möglich, da Google in diesem Fall als eigener Verantwortlicher agiert. Kommunen sollten sich deshalb bewusst sein, dass sie im Falle einer Beschwerde oder Prüfung durch die Datenschutzaufsicht rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden können.
Datenschutz erklären? Klar, verständlich und inklusiv

Datenschutzinformationen sind nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Barrierefreiheit und Bürgernähe. Kommunen sollten Informationen zur Einbindung von Livestreams nicht verstecken, sondern aktiv und verständlich bereitstellen – z. B. mit klarer Sprache, Symbolen oder ergänzenden Erklärvideos. Die Bundesregierung hebt auf ihrer Plattform zur digitalen Gesellschaft hervor, dass digitale Teilhabe für alle Menschen möglich sein muss – unabhängig von Bildung, Sprache oder Einschränkungen. Informationen sollten daher so aufbereitet sein, dass sie leicht verständlich und zugänglich sind. Öffentliche Stellen sollten somit besonders hohe Anforderungen an Transparenz und Zweckbindung erfüllen müssen (cio.bund.de – Digitale Gesellschaft und Teilhabe).
Warum ist digitale Souveränität für Kommunen langfristig wichtig?
Die Frage der Plattformwahl ist auch eine Frage von digitaler Selbstbestimmung. Öffentliche Stellen sollten sich nicht abhängig machen von Plattformen, deren Datenschutzpraxis nicht den europäischen Anforderungen entspricht. Stattdessen sollten europäische Alternativen genutzt werden, um Kontrolle über Daten und Infrastruktur zu behalten. Die Bundesregierung selbst spricht in ihrer Digitalstrategie von „digitaler Souveränität“ als langfristigem Ziel – auch für den öffentlichen Sektor. Lösungen wie von livespotting, die in der EU gehostet werden und keine Drittlandtransfers vorsehen, leisten dazu einen konkreten Beitrag.
Welche DSGVO-konforme Alternative gibt es für HD Live Webcams?

Angesichts dieser Lage ist es für Gemeinden und öffentliche Stellen ratsam, sich nach datenschutzkonformen Alternativen umzusehen. livespotting bietet eine solche Lösung: Das Unternehmen stellt einen Player zur Verfügung, mit dem HD Live Webcams direkt in Webseiten eingebunden werden können, ohne dass dabei personenbezogene Daten an Dritte oder außerhalb der EU übertragen werden.
Alle Dienste von livespotting werden innerhalb der Europäischen Union gehostet. Für Kameras, die öffentliche Räume erfassen, gibt es zusätzlich eine Funktion zur Echtzeit-Anonymisierung: "Blurred" erkennt und anonymisiert automatisch Gesichter und Fahrzeuge, sodass keine identifizierbaren Merkmale mehr übertragen werden. livespotting ist damit eine datenschutzkonforme Webcam-Lösung für Gemeinden, die auf Nummer sicher gehen wollen. Die HD Live Webcam-Technologie von livespotting erfüllt alle Anforderungen an ein datenschutzkonformes Streaming – auch für sensible öffentliche Bereiche. Mehr dazu findet sich auf der offiziellen Webseite unter livespotting.com.
Fazit: Verantwortung übernehmen, sichere Alternativen nutzen

Gemeinden, die YouTube-Livestreams ohne Einwilligung auf ihren Webseiten einbinden, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch einen Vertrauensverlust bei den Nutzern. Angesichts der unsicheren datenschutzrechtlichen Lage in den USA sollte der Verzicht auf die Einbindung von US-Diensten wie YouTube auf offiziellen Webseiten für öffentliche Einrichtungen oberste Priorität haben. Selbst wenn eine Einwilligung der Nutzer vorliegt und entsprechend darauf hingewiesen wird, bleibt der damit verbundene Datentransfer in die USA für eine öffentliche Stelle mehr als fragwürdig. livespotting bietet hier eine datenschutzfreundliche und praxiserprobte Alternative, mit der digitale Öffentlichkeitsarbeit rechtssicher, bürgernah und DSGVO-konform möglich ist.
Deine Kommune möchte HD-Livestreams einbinden, ohne Datenschutzrisiken einzugehen?
Wir bieten Dir eine 100 % DSGVO-konforme Lösung, gehostet in der EU – inklusive Kamera, Player und technischer Umsetzung.
Jetzt unverbindlich beraten lassen:
📞 +49 431 55 68 34 20
📩 [email protected]
Fragen und Antworten (FAQ)
-
chevron_right Ist die Einbindung eines YouTube-Livestreams auf einer Webseite DSGVO-konform?Nein, die Einbindung eines YouTube-Livestreams ohne ausdrückliche Einwilligung der Nutzer stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar. YouTube überträgt personenbezogene Daten wie IP-Adressen in die USA.
-
chevron_right Welche Risiken bestehen beim Einsatz von YouTube auf kommunalen Webseiten?Es drohen Datenschutzverstöße durch Datenübertragung in unsichere Drittländer wie die USA, fehlende Einwilligungen und mögliche Bußgelder durch Aufsichtsbehörden.
-
chevron_right Welche DSGVO-konforme Alternative gibt es zur Einbindung von HD Live Webcams auf Webseiten?livespotting bietet eine datenschutzfreundliche Lösung für Livestreams, bei der keine personenbezogenen Daten in die USA übermittelt werden. Alle Dienste werden in der EU gehostet.
-
chevron_right Warum sollten Kommunen auf YouTube verzichten?Wegen datenschutzrechtlicher Risiken und wachsender politischer Unsicherheiten in den USA sollten öffentliche Stellen auf europäische Streaming-Dienste setzen, um das Vertrauen der Bürger zu stärken.
-
chevron_right Wie funktioniert die automatische Anonymisierung bei Livespotting?Mit der Funktion „Blurred“ werden Gesichter und Fahrzeuge in Echtzeit erkannt und unkenntlich gemacht, sodass keine identifizierbaren Daten im Stream sichtbar sind.
-
chevron_right Müssen Webcams in Echtzeit verpixelt werden, um DSGVO-konform zu sein?Nicht zwingend, aber wenn Personen oder Fahrzeuge identifizierbar sind, ist eine Anonymisierung wie sie „Blurred“ bietet, ein wichtiger Baustein zur DSGVO-Konformität.
-
chevron_right Darf eine Gemeinde eine HD Live Webcam ohne Datenschutzhinweis betreiben?Nein. Jede Datenverarbeitung – auch durch eine Webcam – muss transparent erfolgen. Ein klarer Hinweis in der Datenschutzerklärung ist verpflichtend.
Quellen:
- https://dr-dsgvo.de/youtube-videos-und-die-dsgvo/
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311
- https://www.euronews.com/next/2025/01/23/trump-rollback-jeopardises-eu-us-data-transfers-key-privacy-activist-says
- https://www.theverge.com/2024/9/19/24249073/ftc-data-retention-privacy-report-facebook-meta-youtube-reddit
- https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Rundschreiben/Allgemein/2023/Rundschreiben-Telemedien-02-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=5
- https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/digitalstrategie-der-bundesregierung-2069910
- https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitaler-wandel/digitale-gesellschaft-teilhabe/digitale-gesellschaft-teilhabe-node.html
- https://livespotting.com/de/
Weitere interessante Artikel lesen…